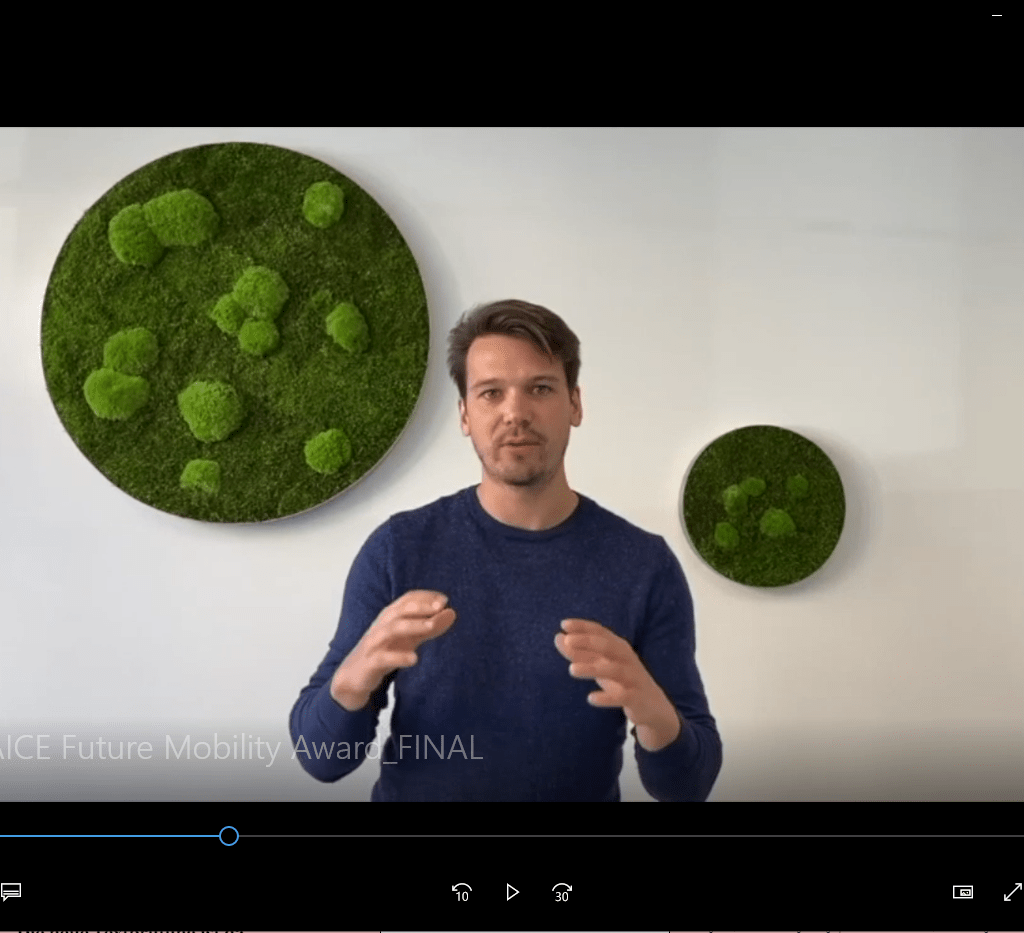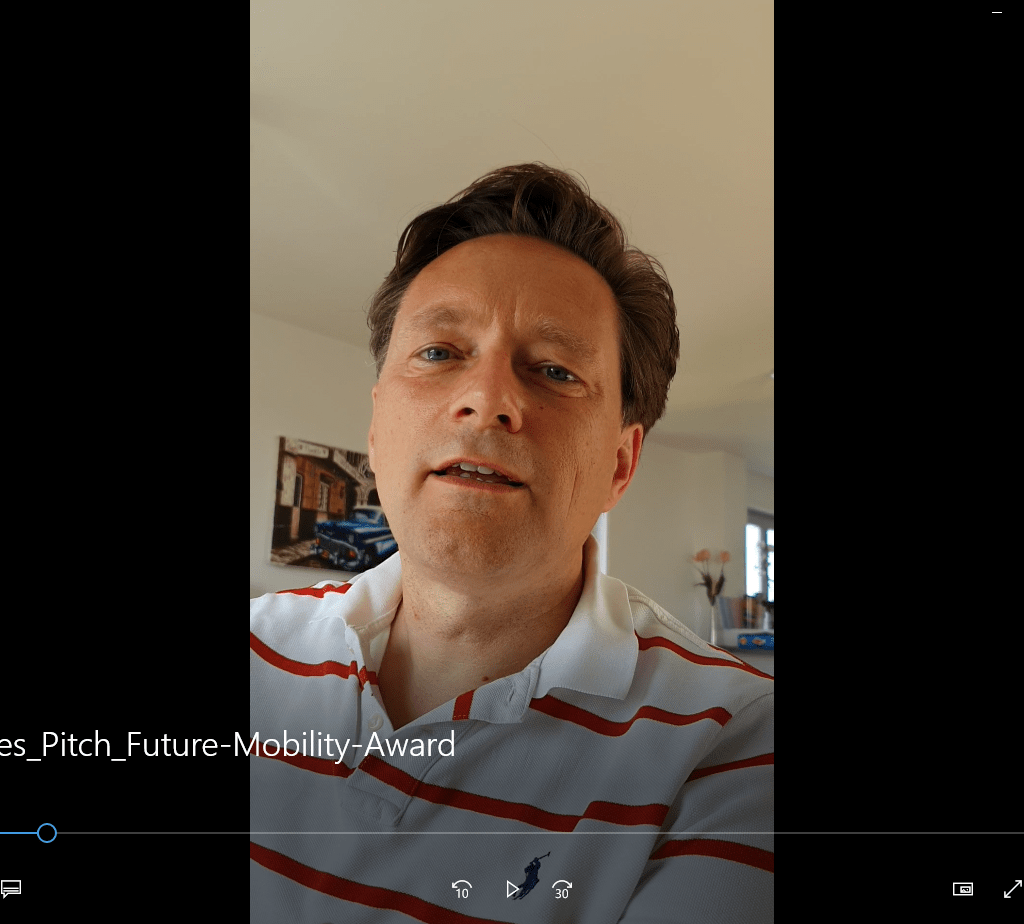Während die Europäische Union ihre Strategie für die wirtschaftliche Erholung vorbereitet, ist die Bedeutung des öffentlichen Nahverkehrssektors (Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr) für die europäische Wirtschaft nicht zu vernachlässigen – der Sektor spielt eine Schlüsselrolle bei der Erfüllung vieler politischer Ziele der EU sowie der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs).
Die ersten verfügbaren Daten aus verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten zeigen, dass das Ökosystem des Personenverkehrssektors auch weiterhin stark von der Pandemie betroffen sein wird. Europaweit rechnet der Sektor bis Ende 2020 mit Verlusten bei den Fahrgeldeinnahmen in Höhe von 40 Milliarden Euro.
Der öffentliche Verkehr ist ein wichtiger Beschleuniger für die Wirtschaft, schafft Arbeitsplätze, fördert die soziale Inklusion und wirkt sich positiv auf die Gesundheit sowie die Umwelt aus. Mit ihrer Unterschrift erkennen die unterzeichnenden CEOs und Städtevertreter diese wichtige gesellschaftliche Rolle an. Mehr als 80 CEOs und Städtevertreter aus fast 20 Ländern haben sich mit der UITP zusammengeschlossen und fordern die europäischen Institutionen dazu auf, die entscheidende Rolle des öffentlichen Verkehrs in ihren Plänen für die wirtschaftliche Erholung anzuerkennen.
Das Überleben des öffentlichen Verkehrs sollte eine Priorität für die Entscheidungsträger auf europäischer Ebene sein. Der öffentliche Personennahverkehr muss in das Konjunkturprogramm einbezogen werden und von den europäischen Maßnahmen zur finanziellen Sanierung profitieren können, damit er überleben und gedeihen kann.
Wir sind stolz darauf, viele große Namen und Mitglieder der Branche zusammenzubringen – darunter STIB, Wiener Linien, RATP, GVB, Volvo, Keolis, Transdev, FGC, Metro Madrid, Irish Rail, SNCF, Alstom, Metro Lisboa, TMB, Hamburger Hochbahn und Warsaw Metro.
Hier finden Sie eine Liste der CEOs, die sich unserer Initiative angeschlossen haben – weitere Branchenführer sind dazu eingeladen, sich ebenfalls zu beteiligen.
Die englische Originalversion der Pressemitteilung finden Sie hier.
Weitere Informationen zur Arbeit der UITP auf europäischer Ebene und Neuigkeiten über die Zusammenarbeit mit den europäischen Institutionen finden Sie auf der Homepage von UITP Europe.
Quelle: UITP Europe