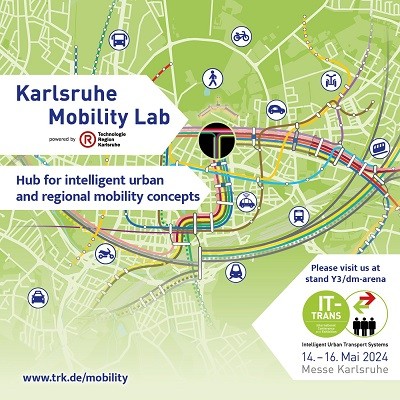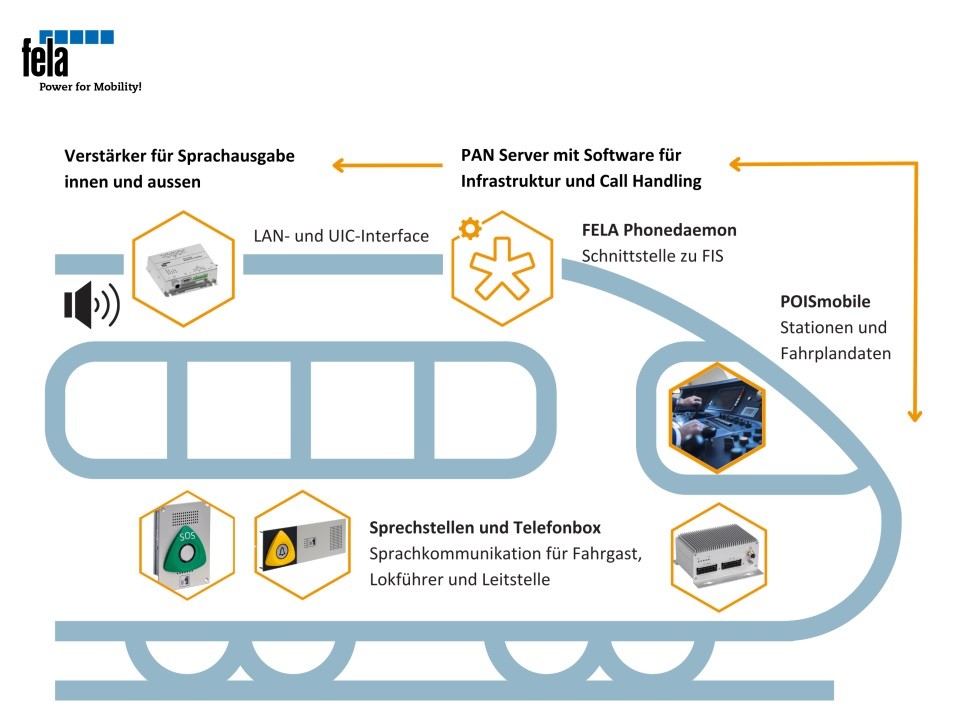Der neue ÖPNV-Report des Landes belegt ein deutlich verbessertes Angebot von Bus und Bahn in Baden-Württemberg. Das ÖPNV-Angebot ist von 2020 bis 2024 landesweit um rund 15 Prozent angewachsen.
Zuwachs bei Bus und Bahn
Das Angebot im landesweiten Busverkehr ist im gleichen Zeitraum um 16 Prozent gestiegen, die Zugkilometer im Schienenpersonennahverkehr des Landes zwischen 2019 und 2023 sogar um 19 Prozent. Das bringt auch kürzere Takte und längere Betriebszeiten.
Die Zahlen aus dem ÖPNV-Report stellte Verkehrsminister Winfried Hermann beim 2. ÖPNV-Zukunftskongress vor knapp 700 Fachleuten in Freiburg vor. Der Minister betonte, dass sich das Angebot im ÖPNV landesweit verbessert habe: „Es geht überall voran bei Bus und Bahn. Die neuen Analysen des ÖPNV-Reports 2024 zeigen zahlreiche Verbesserungen beim Angebot. Und die Menschen im Land haben darauf offenkundig gewartet: Die Fahrgastnachfrage ist auf der Schiene und besonders auch bei den Regiobussen gestiegen. Wir können also noch mehr Fahrgäste gewinnen. Ein gutes Angebot motiviert zum Umstieg. Der landesweite Anteil des ÖPNV an den zurückgelegten Wegen hat sich nach der Corona-Delle noch nicht vollständig erholt. Gemeinsam mit den kommunalen Aufgabenträgern müssen wir weiter Anstrengungen unternehmen, damit Bus und Bahn zuverlässiger und damit noch attraktiver werden.“
Nachhaltige Finanzierung wichtig
Dr. Christoph Schnaudigel, Landrat im Landkreis Karlsruhe, sagte: „Die Landkreise in Baden-Württemberg unterstützen die ÖPNV-Ausbauziele des Landes und sind bereit, ihren Beitrag zu leisten. Für die kommunale Seite steht dabei allerdings fest, dass die Finanzierungsverantwortung für die Sicherstellung der Mindeststandards einer möglichen künftigen Mobilitätsgarantie beim Land liegt. Ohne eine dauerhafte und nachhaltige Finanzierung durch Bund und Land wird es nicht möglich sein, die Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen. Auch der ÖPNV Report 2024 zeigt, dass die Mobilitätswende nur gelingen kann, wenn die kommunale Seite verlässlich ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommt.“
Investitionen lohnen sich
Der Heidelberger Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain machte deutlich: „Der landesweite Angebotsausbau im öffentlichen Nahverkehr ist ein wichtiges Signal – auch für Städte wie Heidelberg. Ein attraktiver, verlässlicher und gut finanzierter ÖPNV ist zentral für eine sozial gerechte und klimagerechte Mobilität der Zukunft. Die Zahlen des aktuellen ÖPNV-Reports zeigen, dass sich Investitionen lohnen: Mehr Angebot führt zu mehr Nachfrage. Gerade jetzt, in Zeiten angespannter kommunaler Haushalte, brauchen wir stabile Rahmenbedingungen und eine gesicherte finanzielle Ausstattung, um den Ausbau auch vor Ort nachhaltig weiter voranzutreiben. Das gilt für Taktverdichtungen ebenso wie für die bessere Anbindung des Umlands. Ein leistungsfähiger Nahverkehr entlastet Straßen, verbessert die Luftqualität und steigert die Lebensqualität in unseren Städten.“
Zuverlässigkeit, Qualität und Sicherheit
Franz Schweizer, Präsident des Verbandes Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer (WBO) sagte: „Als wichtige Säule des ÖPNV im Land sorgen die privaten Busunternehmen insbesondere in der Fläche für die Mobilität der Menschen. Oberste Priorität haben dabei Zuverlässigkeit, Qualität und Sicherheit. Um dies langfristig zu gewährleisten und zur Erreichung der Klimaziele der Verkehrspolitik beizutragen, bedarf es angesichts steigender Kosten und umfangreicher Investitionen einer ausgewogenen, nachhaltigen Finanzierung des ÖPNV. Wir sehen hier neben dem Land auch den Bund in der Verantwortung und zunehmend die Notwendigkeit einer stärkeren Nutzerfinanzierung. Attraktiver ÖPNV ist kostenintensiv. Mit Kompetenz und Einsatz tragen die privaten Busunternehmen dazu bei, dass der ÖPNV seinen Preis wert ist, und wenn die Bürokratie sie nicht ausbremst, sind sie flexibel, nachhaltig, wirtschaftlich und innovativ unterwegs.“
Landesweit solides ÖPNV-Angebot
Die neu in den Report aufgenommenen ÖPNV-Güteklassen zeigen, dass landesweit, also in der Summe aller Stadt- und Landkreise, über 90 Prozent der Bevölkerung durch ein solides Mindest-ÖPNV-Angebot bedient werden. Auch die Fahrgastnachfrage wächst in einzelnen Bereichen des ÖPNV. Einen starken Zuwachs verzeichnen die vom Land bestellten Nahverkehrszüge sowie die vom Land geförderten Regiobusse. Allein die Verkehrsleistung des vom Land bestellten Schienenpersonennahverkehrs stieg von 2019 bis 2024 um über 20 Prozent. Neben einer konsequenten Ausweitung des Angebots hat auch das Deutschlandticket deutlich dazu beigetragen. Auch der Anteil der Verkehrsträger des Umweltverbundes entwickelt sich in Baden-Württemberg positiv: Der sogenannte Modal-Split-Anteil der Verkehrsträger des Umweltverbunds steigt von 42 Prozent im Jahr 2008 auf 46 Prozent im Jahr 2023. In der Entwicklung des Anteils des öffentlichen Verkehrs an den zurückgelegten Wegen (Modal Split Anteil, inklusive Fernverkehr, Taxi et cetera) ist nach einer deutlichen Corona-Delle erst wieder in etwa das Niveau 2017 erreicht.
ÖPNV-Finanzierung unter der Lupe
Eine der Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen des Reports beim Zukunftskongress war die unzureichende Finanzierung des ÖPNV. Einerseits muss der ÖPNV weiter ausgebaut werden, damit die Klimaschutzziele erreicht werden können. Andererseits sind die Kosten für Energie und Personal in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Das Verkehrsministerium hat daher auch die komplexe ÖPNV-Finanzierung genau unter die Lupe genommen. Das verbesserte Angebot im ÖPNV lässt sich auch an den gestiegenen Ausgaben ablesen.
Mehr Geld von Kommunen und Land
Die öffentlichen Haushalte haben für einen Ausbau des ÖPNV in den vergangenen Jahren mehr Geld in die Hand genommen. Insgesamt ist die öffentliche Finanzierung des ÖPNV in Baden-Württemberg von 2018 bis 2024 um 70 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro gestiegen. Pro Kopf betragen die öffentlichen Ausgaben in Baden-Württemberg damit rund 300 Euro pro Jahr. Preisbereinigt sind – im Gegensatz zu den deutlichen Mittelsteigerungen des Landes und der Kommunen – die Mittel des Bundes sogar gesunken, ergibt die Bewertung der Untersuchung.
Hermann: „Trotz der Steigerungen der öffentlichen Mittel ist die Lage der ÖPNV-Finanzierung schwierig: Um den Verkehr weiter auszubauen oder wenigstens zu halten, muss der Bund seiner Pflichtaufgabe besser nachkommen und den ÖPNV insbesondere auf der Schiene auskömmlich finanzieren. Der Bund muss mehr Regionalisierungsmittel zur Verfügung stellen. Der dringend erforderliche weitere Ausbau würde in den nächsten Jahren sonst ausgebremst werden. Auch Baden-Württemberg droht im Schienenverkehr eine Finanzierungslücke, sofern der Bund die Regionalisierungsmittel nicht endlich erhöht. Der neue Koalitionsvertrag der Bundesregierung bleibt hier leider vage.“
Mobilitätspass als neues Finanzierungsinstrument für die Kommunen
Zur Finanzierung des ÖPNV auf kommunaler Ebene dürfte dank des neuen Landesmobilitätsgesetzes auch der Mobilitätspass künftig eine wichtige Rolle spielen. Mit dem Mobilitätspass für Einwohnerinnen und Einwohner oder für Kfz-Halterinnen und Kfz-Halter haben Kommunen jetzt die rechtliche Möglichkeit, zusätzliche Mittel für den Ausbau des ÖPNV zu generieren und gleichzeitig Anreize zu setzen, vermehrt auf den ÖPNV umzusteigen.