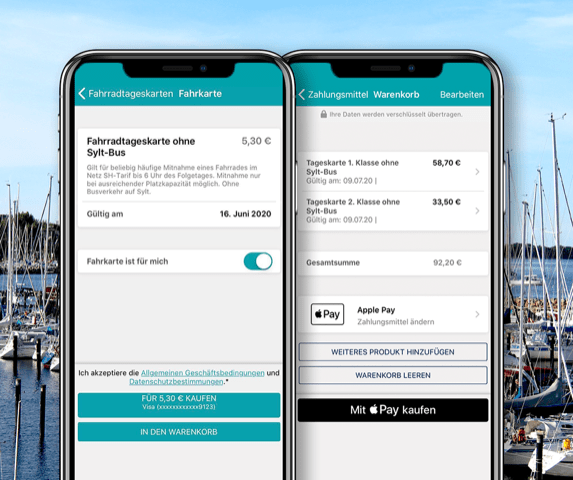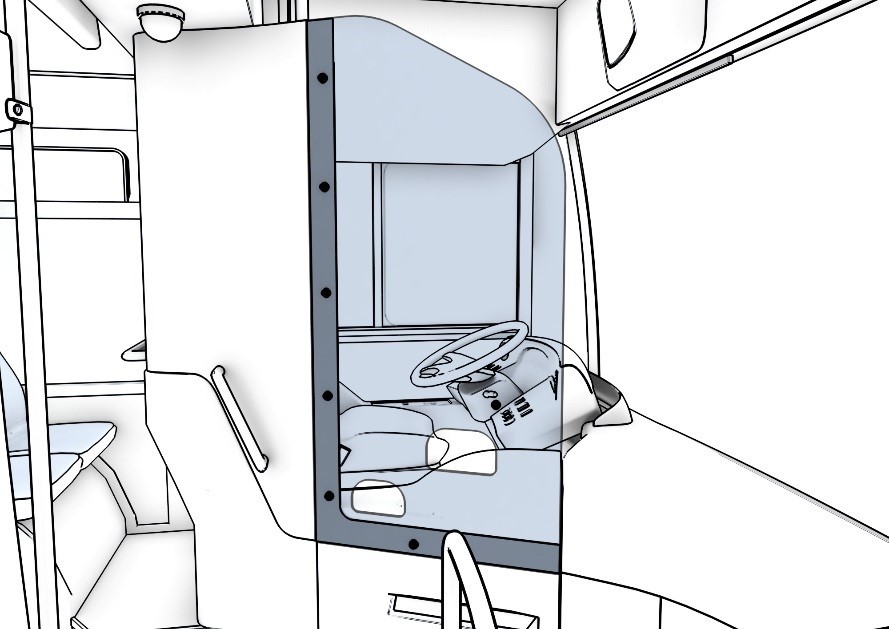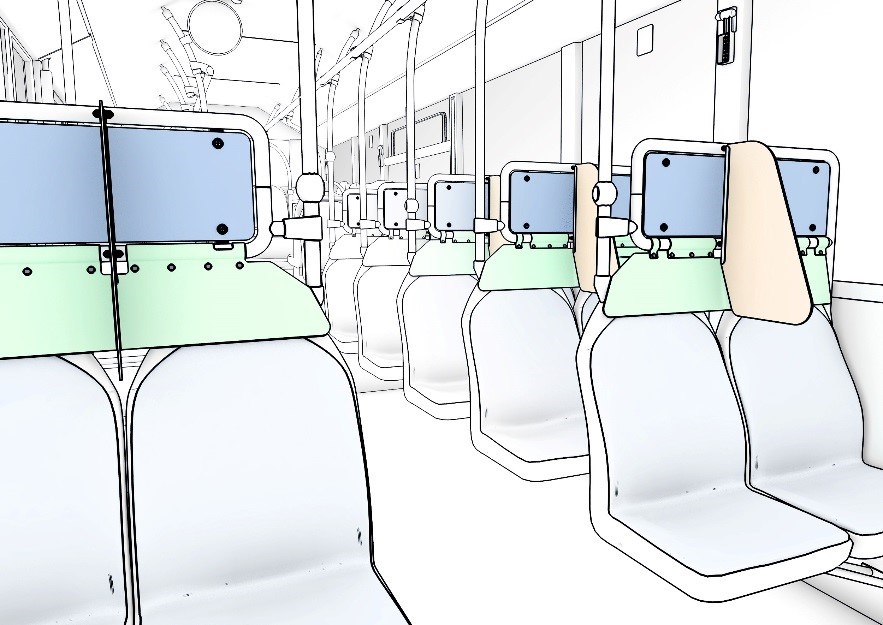Der Klimaschutz war bis Februar 2020 eines der Top-Themen. Die Corona-Pandemie hat dieses wichtige Thema fast vollständig verdrängt, aus nachvollziehbaren Gründen. Dennoch hat sich nichts an der Notwendigkeit des Klimaschutzprogramms und seiner Ziele geändert. Die Mobilität ist dabei eines der großen systemrelevanten Themen. Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben stehen ganz oben auf der Agenda – mit der Transformation vom Verbrenner hin zum lokal emissionsfreien und leisen E-Antriebssystem. Dies wird auch von der Bundesregierung und seinen Vertretern immer wieder klar verdeutlicht und ebenso – zunächst noch zögerlich – von der Automobilindustrie so vertreten. Das war auch so auf der 11. VDV-Elektrobuskonferenz im Februar 2020. Dort wurde immer wieder konstatiert, dass der ÖPNV bereits ein ausgesprochen innovativer und vorbildlicher Partner beim Klimaschutz sei.
Aktuell kommt jetzt ein wichtiger Baustein für die Branche hinzu: Die Förderung für E-Busse inkl. Infrastruktur wird künftig gebündelt und allein vom BMVI verantwortet, statt von mehreren Ministerien mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten. Und noch eine positive Nachricht kam vom Bund: Für E-Bussysteme werden die Fördermittel deutlich aufgestockt. Geld sei genügend da, betonten die Vertreter des Bundes. Dies wurde ausgesprochen positiv aufgenommen, weil es ein notwendiger und konsequenter Schritt für eine erfolgreiche Antriebswende ist.
Und dann schlug im März das Corona-Virus zu! Nichts war mehr so wie es war: Abstandsregelungen, Kontaktbeschränkungen, Hygienemaßnahmen, Maskenpflicht kamen als klare Verordnungen. In Bussen und Bahnen gingen die Fahrgastzahlen Klimaschutzprogramm des Bundes: Effiziente und hochverfügbare Elektrobussysteme sind unverzichtbar Förderprogramme für Fahrzeuge und Infrastruktur sind dabei wichtige Voraussetzungen. rapide zurück. Die Verkehrsunternehmen haben dennoch mit Beginn der Corona-Pandemie mit großem Augenmaß das Angebot insbesondere wegen der Abstandsregelung vielfach auf fast bisherigem Niveau gehalten. Die Folge waren große Fahrgeldausfälle. Der VDV und die Branchenverbände unterstützen nunmehr die Initiative der Landesverkehrsminister, vom Bund die Einrichtung eines „ÖPNV-Rettungsschirms“ in Höhe von mindestens 5 Mrd € zu erhalten. Dabei muss es das unbedingte Ziel sein, den ÖPNV als einen der wichtigsten Partner im Klimaschutz für die Noch-Coronazeit zu stärken und weiter auszubauen.
Noch etwas ist seit Beginn der Corona-Krise deutlich geworden: Nicht nur die Fahrzeuge des ÖPNV und die Straßen waren leer, wie man es bisher nicht kannte. Es gab keine Staus und die Schadstoff- und Geräuschbelastungen waren deutlich reduziert. Dass dies so sein würde, lag auf der Hand – dass dies aber nach Corona nicht so bleibt, ist auch klar. Die Probleme der schädlichen Klimaentwicklung sind nicht verschwunden, sie sind lediglich verschoben und kommen ggf. infolge einer vermehrten Pkw-Nutzung stärker zurück!
Genau hier liegen jetzt die größten Herausforderungen für Politik, Wissenschaft und Wirtschaft sowie für unsere gesamte Gesellschaft. Alle bisherigen innovativen Entwicklungen und Maßnahmen für eine klima- und umweltschonende Mobilität, so auch der E-Bus, sind nach wie vor richtig, auch wenn manche Dinge neu und noch konsequenter gedacht werden müssen. Die Rückkehr der Fahrgäste in den ÖPNV wird aber voraussichtlich noch längere Zeit dauern, so das Ergebnis einer aktuellen Studie des DLR: Gewinner der Corona-Krise sind aktuell der Pkw und das Fahrrad, so Prof. Barbara Lenz, Direktorin des DLR-Instituts für Verkehrsforschung. Der private Pkw weist derzeit (!) in der Umfrage einen deutlichen „Wohlfühlfaktor“ gegenüber allen anderen Verkehrsmitteln auf. Problematisch ist es deshalb für den ÖPNV, die verlorenen Fahrgäste zügig zurückzugewinnen, so die Studie. Was keinesfalls passieren darf, ist der Verzicht auf ÖPNV-Fahrten und der Umstieg in den privaten Pkw. Dann würden alle bisherigen Überlegungen, Maßnahmen und Strategien im Kampf gegen den Klimawandel ad absurdum geführt.
Was das wiederum für den Verkehr besonders in den Städten bedeuten würde, ist allen klar. Die Verkehrssituation würde angesichts dieses „Autowohlgefühls“ sehr schnell kollabieren mit allen bekannten Negativerscheinungen. Deshalb muss auch weiterhin alles darauf ausgerichtet sein, dass ein starker ÖPNV mit Bussen und Bahnen die Hauptlast der Mobilität trägt und durch komplementäre Angebote sinnvoll und effizient ergänzt wird. Denn nur mit einem starken und gut ausgebauten ÖPNV – mit Förderung des Bundes – ist die Verkehrswende zu schaffen. Genau deshalb müssen die zugesagten Förderprogramme für E-Busse und deren Infrastruktur weiterhin festen Bestand haben sowie für den ÖPNV-Rettungsschirm neu dazukommen. Dass dies angesichts der Corona-Pandemie vom Bund zur Stützung der Wirtschaft und der Konjunkturstabilisierung bereitgestellten Finanzmittel in Milliardenhöhe nicht einfach ist, ist selbstredend. Dennoch, der weitere Ausbau des ÖPNV sowie die vielen innovativen Themen und Projektförderungen für die Mobilität der Zukunft muss weiterhin höchste Priorität haben. Denn Corona ist bald wieder vorbei und alle alten und bekannten Probleme sind wieder da! Dann gilt wie bisher, dass das Bussystem eines der effizientesten und flexibelsten Verkehrsmittel ist und gerade deshalb dringend gebraucht wird. Ein E-Bussystem ist für eine nachhaltige Mobilität mit „Zero Emission“ und fast geräuschlosem Antrieb einer der besten Wege zur Erreichung der Klimaschutzziele.
Wie sagte Martin Schmitz, VDV-Geschäftsführer Technik, auf der Elektrobuskonferenz: „Dies ist das Jahrzehnt des Busses!“ Dieser Satz ist immer noch richtig. Deshalb muss die Entwicklung und Förderung des elektrischen Antriebs von Bussen auch weiterhin einen hohen Stellenwert haben. Dabei ist eine unbedingte Technologie-offenheit anzustreben. Als E-Busse werden deshalb sowohl reine Batteriebusse als auch Oberleitungs- und Brennstoffzellenbusse bezeichnet – alle werden von Elektromotoren angetrieben. Erwähnt sei auch, dass ebenso synthetische und Bio-Kraftstoffe vom Bund gefördert werden. Die Technologieoffenheit findet in der Branche einen breiten Konsens. Dies liegt auch an vielfach langen Umläufen. Dafür braucht man Busse mit großen Reichweiten. Hier liegt die Stärke von Brennstoffzellenbussen, ggf. mit einem Range-Extender als Verlängerer der Reichweite.
Dies zeigt, dass verschiedene Antriebstechnologien je nach Anforderungs- und Einsatzprofil sinnvoll sind. Es gibt somit gemäß vieler Vortragender zu Recht keine klare Präferenz für den einen oder anderen elektrischen Antrieb, alle haben gewisse Stärken und Schwächen. Viele Verkehrsunternehmen haben deshalb Erprobungen der Praxistauglichkeit von E-Bussen durchgeführt und vielfach bereits ihre Präferenz festgelegt oder zumindest als Option offengehalten. Wasser-stoff betriebene Brennstoffzellenantriebe kommen zunehmend zum Einsatz, so z.B. in Wuppertal, bei der RVK in Köln und in Hamburg. Schleswig-Holstein und Hamburg planen sogar gemeinsam Anlagen zur Elektrolyse von Wasserstoff, die vornehmlich mit regenerativer Windenergie betrieben werden sollen. Jetzt kommt es darauf an, dass die Bushersteller auch in der Lage sind, stabile und serienmäßige Elektrobussysteme mit normalen (!) Lieferzeiten zu akzeptablen Preisen zu liefern. Die Erwartungen für einen Markthochlauf mit ausgereiften Fahrzeugen und hohen Stückzahlen, insbesondere in größeren Städten mit Umweltproblemen, müssen deshalb jetzt erfüllt werden. Der rechte Schwung hierfür fehlt noch. Insgesamt ist aber immer noch eine verschwindend kleine Anzahl von E-Bussen im Einsatz, was auch an den immer noch deutlichen höheren Kosten für komplette E-Bussysteme liegt.
Wenn auch der Optimismus von VDV-Präsident Ingo Wortmann im Februar angesichts der positiven Förderzusagen für Elektrobusse durch den Bund noch groß war, kann jetzt nur noch gehofft und gefordert werden, dass dies auch wirklich trägt, denn für die Ziele des anspruchsvollen Klimaschutzprogramms ist der elektrische Antrieb unverzichtbar. Jede Stadt und jede Region muss für die Beschaffung seines E-Bussystems die eigenen Rahmenbedingungen zugrunde legen, wenn ein bestmögliches Ergebnis dabei herauskommen soll. Dennoch, von allen Beteiligten sind angesichts der Corona- Auswirkungen für den ÖPNV große Anstrengungen zu unternehmen, um die Probleme der Krise zu bewältigen und den ÖPNV wieder dahin zu bringen, wo er hingehört: Als wichtiger Problemlöser des Klimawandels, und dies mit Elektrobussen.
Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen Auszug aus der Juni-Ausgabe der Nahverkehrs-praxis! Jetzt digital kostenfrei lesen – für kurze Zeit