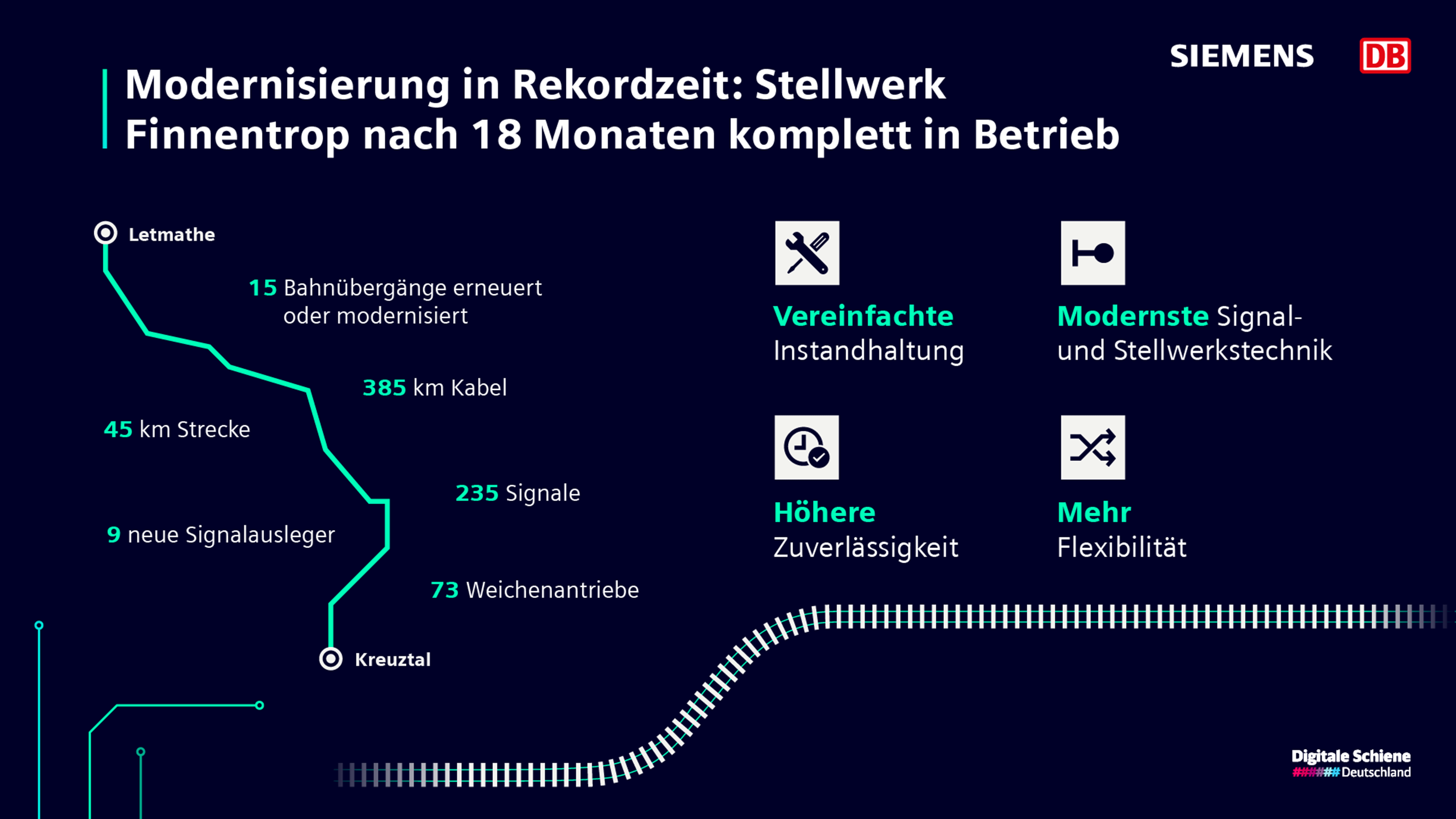Die Verkehrsbehörde Central Puget Sound Regional Transit Authority (Sound Transit) hat zusammen mit sechs weiteren Verkehrsunternehmen die nächste Generation des elektronischen Fahrgeldmanagements im Großraum Seattle, Washington/USA eingeführt. Es löst das bisherige kartenbasierte System ab, firmiert für die Fahrgäste aber weiterhin unter dem Markennamen ORCA. Mit dem neuen kontenbasierten INIT System wird das Kundenerlebnis erheblich verbessert, da es eine Kontoverwaltung in Echtzeit und neue Zahlungsoptionen bietet, für die Sicherheit der Kundendaten sorgt und künftig Mobile Ticketing ermöglicht.
Das Fahrgeldmanagementsystem ORCA umfasst die verschiedensten Verkehrsträger, darunter Linienbusse, Stadt- und Straßenbahnen, Fähren und Wassertaxis von Sound Transit und sechs weiteren Verkehrsunternehmen. „Der Schlüsselpunkt des ORCA-Projekts war die Migration des Back-Office-Systems und der mehr als 6.000 zugehörigen Geräte. INIT führte diese Umstellung innerhalb von 48 Stunden durch und ermöglichte es der Behörde, den Service und die Einnahmenerhebung mit minimaler Unterbrechung fortzusetzen”, erklärt Eric Linxweiler, INIT COO in Seattle. “Die Einführung des neuen ORCA-Systems ist ein gewaltiger Schritt in der Entwicklung moderner Fahrgeldmanagementsysteme.”
Das Herzstück des ORCA-Systems der nächsten Generation ist MOBILEvario, INITs leistungsstarkes Hintergrundsystem für das elektronische Fahrgeldmanagement. MOBILEvario wird die Einnahmenaufteilung zwischen den sieben Partnerunternehmen übernehmen und die Kontenverwaltung ermöglichen.
Das System ist sowohl „Visa Ready for Transit“ zertifiziert als auch PCI- (Payment Card Industry) und EMV (Europay, MasterCard® und Visa®)- zertifiziert für die Akzeptanz von kontaktlosen sowie von virtuellen Karten, die in einer mobilen App gespeichert sind. Die INIT Ticket Terminals ermöglichen an Bord der städtischen und regionalen Busse und an den Haltestellen ein einfaches Tap-and-Go-Boarding. Darüber hinaus tragen sie das ITxPT Label, was sicherstellt, dass die Terminals über eine offene Architektur verfügen und Interoperabilität ermöglichen.
Künftig werden den Kunden auch die hochmodernen Fahrkartenautomaten von INIT an Bahnhöfen in der gesamten Region zur Verfügung stehen. Diese werden nach und nach in Betrieb genommen, während die alten Automaten ausgemustert werden – so wird den ORCA-Kunden die Umstellung während der Einführungsphase erleichtert. ORCA-Kunden können ihre vorhandenen ORCA-Karten weiterhin verwenden. Das ermöglicht einen nahtlosen und komfortablen Übergang zum neuen, offenen Tarifsystem.
“Wir freuen uns, den Millionen ORCA-Nutzern in Puget Sound Region das neue ORCA-System, die Website und die mobile App zur Verfügung stellen zu können”, sagt Brittany Esdaile, Direktorin für regionale Tarifsysteme. “Das neue System bietet mehr Effizienz und Komfort durch das nun mögliche Aufladen von Guthaben in Echtzeit und endlich auch eine Tap-to-Pay-Option für Smartphones.”
Quelle: INIT