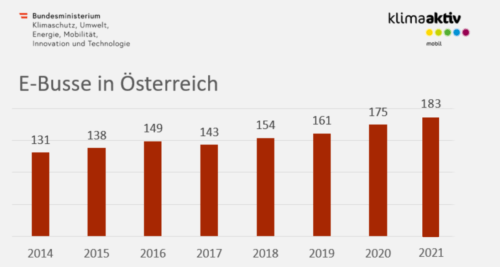Die National Express Rail GmbH hat nach der Linie RE 1 (RRX) am 01.02.2022 heute nun auch den Betrieb der Linie RE 11 (RRX) erfolgreich aufgenommen. Mit dem Betriebsstart endet der im Januar in Kraft getretene Übergangsfahrplan. Die Linie RE 11 (RRX) verkehrt nun wieder gemäß dem regulären Fahrplan zwischen Düsseldorf und Kassel.
Die Halte Dortmund Hbf, Kamen Methler, Kamen und Hamm in Westfalen werden aufgrund von Baumaßnahmen im Dortmunder Hbf bis voraussichtlich April 2023 nicht bedient. Die Halte Dortmund-Hörde und Unna fungieren bis dahin als Umleitungshalte für die RE 11 (RRX). Alternativ können Fahrgäste die Linien RE 1 (RRX), RE 3 und RE6 (RRX) über Dortmund Hbf nach Hamm in Westfalen nutzen
Zum 1. Februar 2022 hatte National Express den Betrieb der bisher von Abellio Rail GmbH betriebenen Linien RE 1 (RRX) und RE 11 (RRX) im Rahmen einer bis Dezember 2023 befristeten Notvergabe übernommen. Damit ist National Express nun alleiniger Betreiber sämtlicher RRX-Linien.
„Unser besonderer Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Außergewöhnliches geleistet und so den erfolgreichen Start unserer nun fünften RRX-Linie möglich gemacht haben. Wichtig für den Erfolg war aber auch die konstruktive und kooperative Zusammenarbeit mit dem vorherigen Betreiber Abellio. Wir freuen uns über den Zuwachs der vielen, erfahrenen und talentierten Leute und sind unglaublich stolz auf unser nun komplettes Team“
Marcel Winter, Geschäftsführer der National Express Rail GmbH
Für die Betriebsübernahme der Linien RE 1 (RRX) und RE 11 (RRX) waren die Erfahrungen, die das Unternehmen bei den vorherigen RRX-Mobilisierungen der Linien RE 5 (RRX), RE 6 (RRX) und RE 4 sammeln konnte, von großem Vorteil. Dennoch stand National Express hier vor einer Ausnahmesituation. Bei bisherigen Betriebsübergängen standen für die Umsetzung einer Mobilisierung etliche Monate bis Jahre zur Verfügung. Der betriebliche und personelle Übergang des Vorbetreibers Abellio Rail GmbH auf National Express im Rahmen der Notvergabe musste binnen weniger Wochen vollzogen werden. Durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte National Express den Betriebsübergang sowie den Betriebsstart der Linien RE 1 (RRX) und RE 11 (RRX) ohne größere Einschränkungen für die Fahrgäste bewerkstelligen.
Quelle: National Express