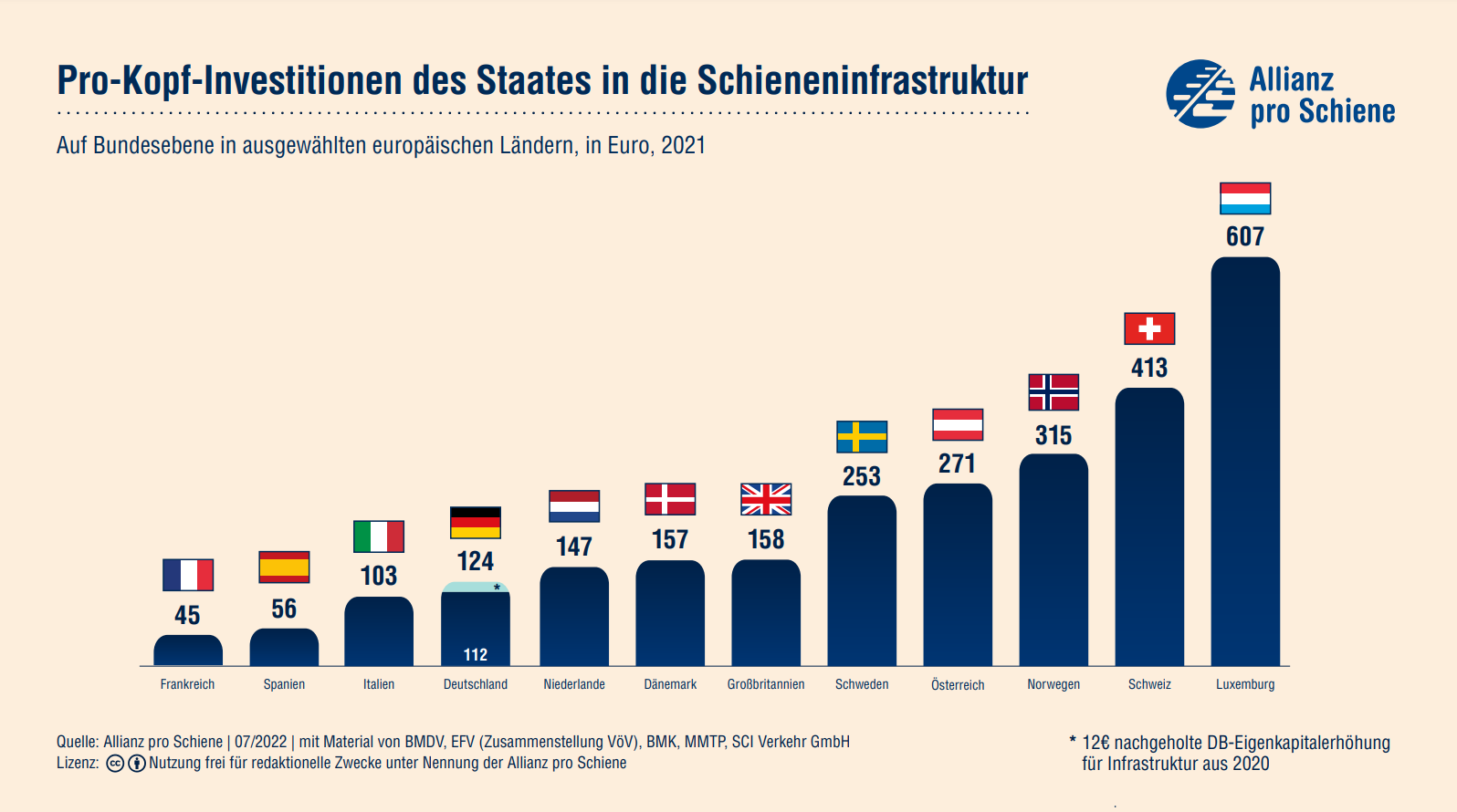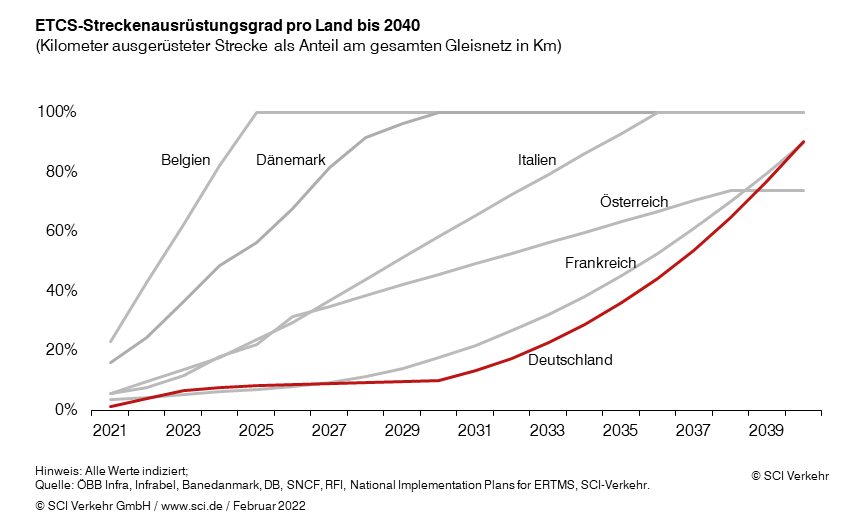Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) ändert zum 1. September 2022 die Beförderungsbedingungen im Elektronetz Mittelsachsen. Dem in Deutschland bewährtem Modell „Zustieg nur mit gültiger Fahrkarte“ schließt sich die MRB mit dieser Neuregelung zur Verbesserung der Servicequalität gegenüber den Fahrgästen an.
Demnach ist auf den Linien RE 3 (Dresden – Hof), RB 30 (Dresden – Zwickau) und RB 45 (Chemnitz – Elsterwerda) ein Ticketkauf im Zug ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. In etlichen Regionen Sachsens wie etwa im VVO- oder MDV-Gebiet ist dies bereits seit längerer Zeit Standard. Die Kundenbetreuer sollen dadurch entlastet werden, um sich schwerpunktmäßig auf eine intensive Fahrgastbetreuung und -information, z.B. bei Tarif- oder Fahrplanauskünften sowie beim Sicherstellen von Anschlusszügen fokussieren zu können.
Tickets sind ab dem 1. September vor Fahrtantritt im MRB-Vorverkauf sowie an den Vorverkaufsstellen sonstiger Eisenbahnverkehrsunternehmen zu erwerben. Über die App „MRB Tickets & Infos“ erhalten Fahrgäste ganz einfach und bequem ihren Fahrschein: App im Playstore downloaden, schnell und unkompliziert registrieren, Ticket kaufen und losfahren. Neben dem digitalen Verkauf sind Tickets auch an allen Fahrkartenautomaten sowie Kundencentern und Partneragenturen der MRB erhältlich. An allen Stationen, an denen es keine Vorverkaufsmöglichkeiten wie Kundencenter oder Fahrkartenautomat gibt, kann weiterhin ein Ticket im Zug erworben werden. Fahrgäste müssen sich in dem Fall unmittelbar nach dem Zustieg aktiv beim Kundenbetreuer melden. Eine EC-Kartenzahlung ist an diesen Stationen ab einen Ticketpreis von 5 € möglich.
Die MRB informiert ab sofort umfangreich ihre Fahrgäste zu den Änderungen ab 1. September.
Quelle: MRB