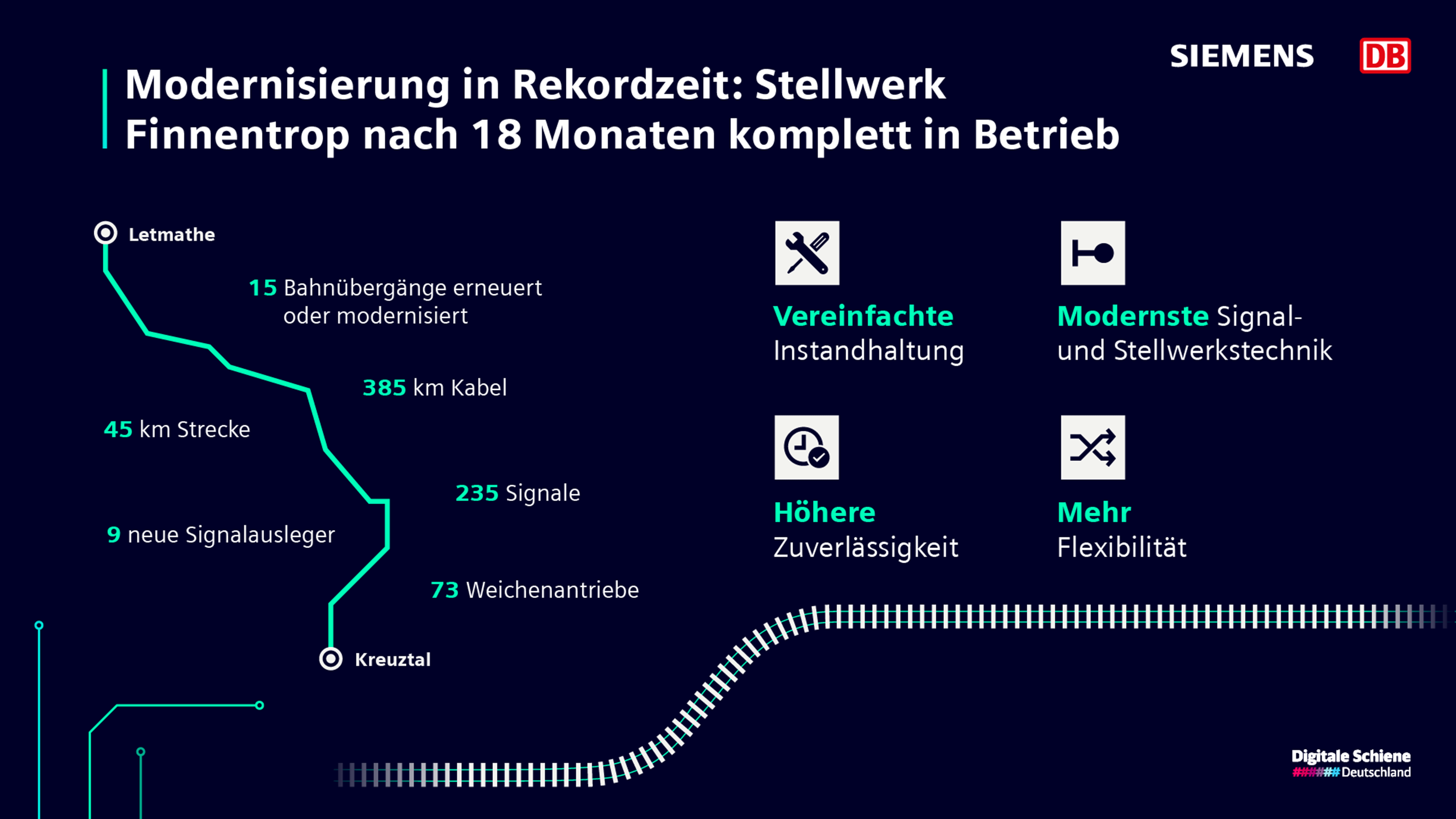Kommentar von Markus Schlitt, CEO Yunex Traffic (gekürzt)
Für 9 Euro pro Monat einmal quer durchs Land: Das ist in Deutschland seit dem 1. Juni 2022 möglich. Die Regierung versucht mit dieser Maßnahme, die Bürger von den steigenden Benzinpreisen und Lebenshaltungskosten zu entlasten. Und mehr Menschen zu motivieren, vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen. Aber führt eine Preisreduktion wirklich zum gewünschten Ziel?
Den Versuch, die Attraktivität des ÖPNV über Preissenkungen zu steigern, haben vor Deutschland schon zahlreiche Städte und Länder versucht. So fahren beispielsweise die Bewohner und Besucher Luxemburgs schon seit 2020 komplett kostenfrei durchs Land, gleiches gilt in der estnischen Hauptstadt Tallinn. In beiden Gegenden sind Verkehrsteilnehmer auf Busse und Bahnen umgestiegen – jedoch nicht vom Auto. Vielmehr waren es Fußgänger und Fahrradfahrer, die sich durch geringere Kosten dazu animieren ließen, Bequemlichkeit über Beweglichkeit zu stellen.
Deutschland wagt nun einen neuen Versuch. Und das in einer Zeit, in der viele Haushalte jeden Euro doppelt umdrehen müssen, um ihren Alltag finanzieren zu können. Gerade diese Menschen profitieren enorm von der Möglichkeit, für nur 9 Euro pro Monat mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durchs Land zu fahren. Es ist auch eine Zeit nach der Hochphase einer Pandemie, in der Menschen aus Sorge um ihre Gesundheit öffentliche Verkehrsmittel gemieden haben. Indem der Staat Bürgern einen weiteren Grund gibt, vom Auto in Bus und Bahn umzusteigen, geht er einen ersten, wichtigen Schritt, viele dieser Menschen wieder zurück in Bus und Bahn zu locken.
Doch er darf nicht der Einzige sein. Damit die Öffentlichen langfristig die Verkehrsmittel erster Wahl bleiben, dürfen wir uns nicht von der Preisproblematik ablenken lassen, sondern müssen das eigentliche Problem anpacken. Denn die Beispiele aus Tallinn und Co. zeigen: Der Preis ist nicht das Problem.
Dass immer noch eine Vielzahl von Menschen das Auto den öffentlichen Verkehrsmitteln vorzieht, hat vielfältige Ursachen. Im ländlichen Raum fehlt beispielsweise das Angebot. Ein Bus pro Stunde? Eine Haltestelle pro Dorf? Verständlich, dass ein Leben ohne Auto unter solchen Mobilitätsumständen kaum vorstellbar ist. Für Menschen mit eingeschränktem Mobilitätsvermögen erschweren die letzte und erste Meile von und zur Haltestelle die Reise mit Bus oder Bahn. Denn diese muss in den meisten Fällen zu Fuß zurückgelegt werden. Und nicht zuletzt ist es die mangelhafte Zuverlässigkeit der öffentlichen Verkehrsmittel, die Bürger ans Auto bindet. Solange Verkehrsteilnehmer Komforteinbußen in Kauf nehmen müssen, wird der ÖPNV die zweite Wahl bleiben.
Wenn wir Menschen wirklich dazu motivieren möchten, vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen, müssen Busse und Bahnen eine echte Alternative zum komfortablen Individualverkehr darstellen. Wir müssen dem ÖPNV Vorfahrt im Verkehr geben, sodass die Mitfahrer als Erste am Ziel sind. Wir müssen die Elemente im Verkehrsökosystem so verknüpfen, dass eine reibungslose Reise von Tür zu Tür und von Stadt zu Stadt möglich wird, auch und vor allem für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Wir müssen das Angebot im ländlichen Raum erweitern und das städtische Umland an den urbanen Raum anbinden, sodass der ÖPNV auch die Bedürfnisse der Menschen außerhalb der Ballungszentren erfüllt.
Damit der ÖPNV eine echte Alternative zum Auto darstellen kann, darf sich der Staat nicht von Diskussionen um die Preispolitik davon abhalten lassen, das eigentliche Problem anzugehen und den ÖPNV aufzurüsten. Das heißt auch, das Angebot auszuweiten, aber vor allem, die Infrastruktur aus dem Winterschlaf zu wecken.
Die Investitionen in das 9-Euro-Ticket wären hierfür ein guter Anfang. Mit diesem Geld könnten beispielsweise neue Busse beschafft und die Verkehrsinfrastruktur auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Während die Preisreduktion lediglich kurzfristige Effekte mit sich bringen wird, würden sich diese Investitionen langfristig auszahlen – sowohl für Mobilitätsbetreiber als auch Verkehrsnutzer. Vor allem aber für die Umwelt.
Quelle: Yunex Traffic