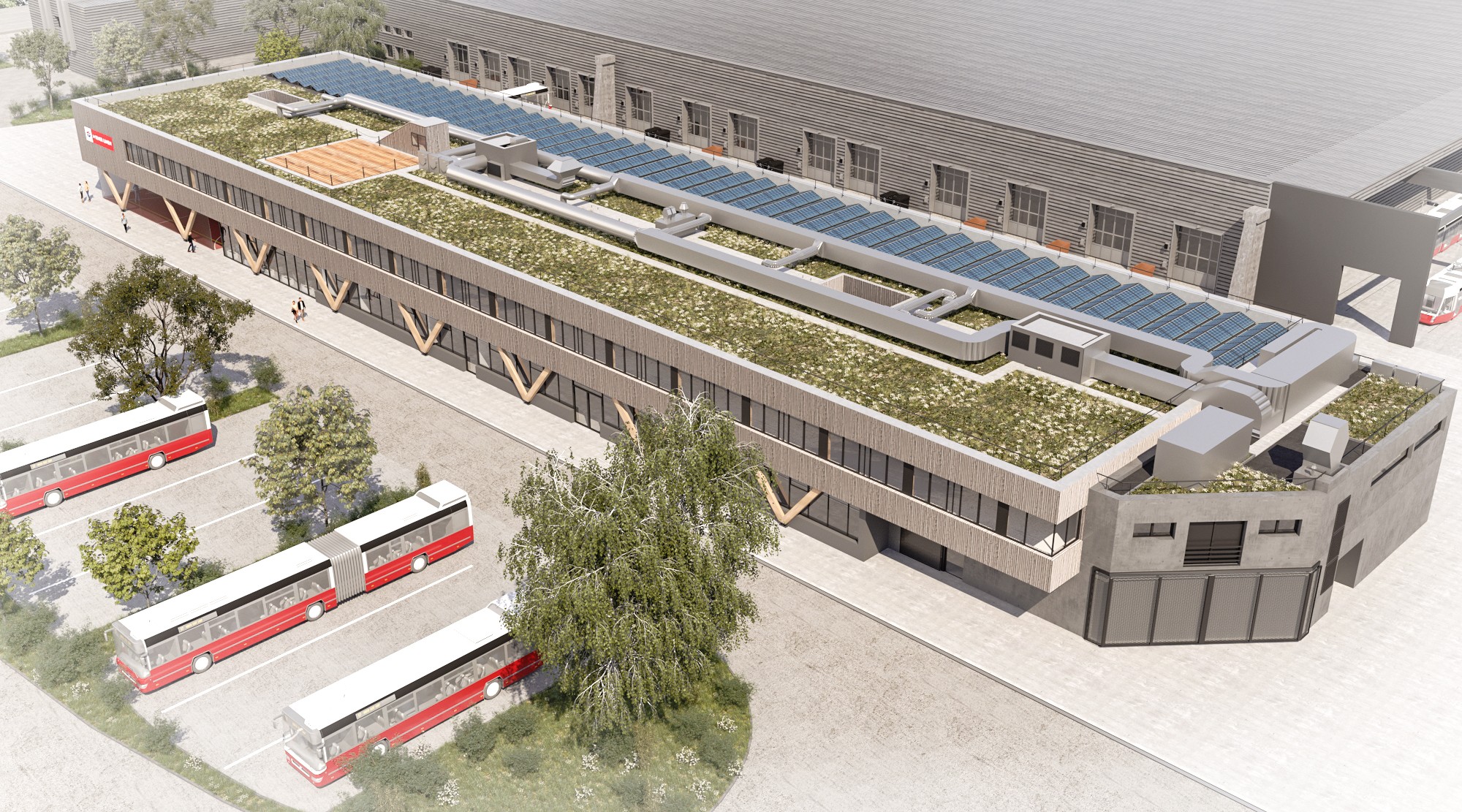Die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) erneuern ab Montag, 14. März 2022, im Bereich Implerstraße Weichen, Kreuzungen und Schienen. Während der Arbeiten bis Mitte Juni 2022 werden die U-Bahnlinien U3 und U6 zwischen Goetheplatz und Implerstraße durch Busse ersetzt. Der Schienenersatzverkehr (SEV) auf diesem stark frequentierten Streckenabschnitt und darüber hinaus ist im Hinblick auf Takt und Anzahl der Fahrzeuge der umfassendste Ersatzverkehr in der Geschichte der MVG – bis zu 42 Busse sind zusätzlich im Einsatz.
Die SEV-Busse pendeln nicht nur auf dem für die U-Bahn gesperrten Abschnitt. Um die Zahl der Umsteigevorgänge für die betroffenen Fahrgäste möglichst gering zu halten, verkehrt die Ersatzbuslinie U3 von der Brudermühlstraße kommend ab Goetheplatz weiter zum Hauptbahnhof (Haltestelle an der Südseite in der Bayerstraße) und bietet damit eine Vielzahl an Umsteigemöglichkeiten zu den U-Bahn-Linien U1, U2, U4, U5, U7 und U8, zur Tram sowie zur S-Bahn-Stammstrecke.
Zusätzlich wird eine SEV-Linie U6 als Ringlinie von der Implerstraße über die Poccistraße zum Goetheplatz und über die Haltestelle Tumblingerstraße zurück zur Implerstraße eingerichtet. Neben den SEV-Linien U3 und U6 verlängert und verstärkt die MVG während der Bauarbeiten zusätzlich bestehende Linien, um auch weiträumige Möglichkeiten zur Umfahrung der Baustelle anzubieten.
Als weitere Alternative können Fahrgäste den gesperrten Streckenabschnitt auch mit einem MVG Rad überbrücken. Bei der Rückgabe des Bikes an den Radstationen Brudermühlstraße, Implerstraße und Kreisverwaltungsreferat sowie den temporär geschaffenen Stationen am Goetheplatz und am Sendlinger Tor erhalten Nutzer automatisch eine Gutschrift von zehn Freiminuten. Für die Nutzung des „MVG Rad“ ist eine Registrierung und der Download der App „MVGO“ erforderlich.
Nördlich des U-Bahnhofs Implerstraße tauschen SWM und MVG insgesamt acht Weichen, zwei Kreuzungen sowie Schienen, Schwellen und Schotter. Außerdem werden die Stromschienen für die Energiezufuhr in die Fahrzeuge erneuert. Diese Arbeiten sind wegen der komplexen Anordnung der Weichen und Gleiskreuzungen und der engen Arbeitsfläche im Tunnel nur im Rahmen einer Vollsperrung möglich. Damit schaffen SWM und MVG die Voraussetzungen für einen weiterhin stabilen U-Bahn-Betrieb auf den Linien U3 und U6. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Sonntag, 19. Juni 2022.
Ausführliche Informationen sind unter mvg.de/impler abrufbar.
Quelle: MVG