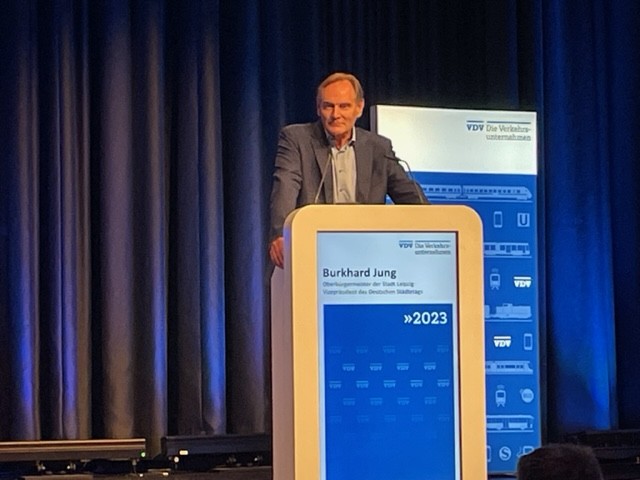Einmal jährlich legt go.Rheinland (ehemals Nahverkehr Rheinland) einen Qualitätsbericht für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) vor. Dieser hilft dabei, die Entwicklungen im SPNV nachzuvollziehen, Hintergründe zu erkennen und Handlungsansätze für die Zukunft zu skizzieren. Allerdings standen die beiden letzten Jahre 2022 und 2021 unter dem Einfluss außergewöhnlicher externer Faktoren: „Nachdem uns zuvor das Unwetter »Bernd« und die Corona-Pandemie vor besondere Herausforderungen gestellt haben, waren dies im Laufe des vergangenen Jahres das 9-Euro-Ticket und die immer komplexer werdenden Baustellen“, so go.Rheinland-Geschäftsführer Dr. Norbert Reinkober. „Von daher können die Ergebnisse nicht mit denen der Jahre zuvor in einen direkten Bezug gesetzt werden.“ Sorgen bereitet momentan die zunehmende Personalknappheit. „Wir gehen davon aus, dass es in den kommenden Monaten – trotz intensiver Personalgewinnungs- und Ausbildungsaktivitäten der Bahnunternehmen – zu weiteren Zugausfällen kommen wird“, so Reinkober.
Verspätungssituation verschärft sich weiter
Nachdem die Zugverspätungen zwischen 2018 und 2020 immer weiter abgenommen hatten, nehmen sie seit 2021 wieder zu. Im Jahr 2022 lag die durchschnittliche Verspätung über die drei Produktgruppen Regionalexpress (RE), Regionalbahn (RB) und S-Bahn hinweg bei 3:05 Minuten. Damit waren die Züge im Vergleich zu 2021 (2:05 Minuten) genau eine Minute unpünktlicher. Dies entspricht einer Verschlechterung von 48 Prozent. Die höchsten Verspätungswerte wurden in den Monaten des 9-Euro-Tickets im Juni, Juli und August 2022 eingefahren. Durch die deutliche Zunahme an Fahrgästen stieß das Bahnsystem insbesondere an den Wochenenden an seine Grenzen. Es kam zu langen Fahrgastwechselzeiten an den Bahnhöfen und damit zu hohen Verspätungen. Weitere Gründe für die verschärfte Situation sind die Zunahme von Netzüberlastungen, Trassenkonflikten und Verspätungsübertragungen an den zentralen Bahnknoten in Aachen, Bonn und Köln. Alle Produktgruppen haben sich gegenüber dem Jahr 2020 verschlechtert, die pünktlichsten Werte weisen weiterhin die S-Bahnen auf. Hier kam es zu einem Anstieg auf 2:14 Minuten (plus 59 Prozent). Bei den RB-Linien stiegen die Verspätungswerte auf 2:58 Minuten (plus 73 Prozent) und bei den RE-Linien auf 4:17 Minuten (plus 119 Prozent).
Deutlicher Rückgang bei den Zugausfällen
Vor allem die Flutkatastrophe im Juli 2021 hatte zu neuen Höchstwerten bei den Zugausfällen geführt. Für das go.Rheinland-Gebiet lässt sich nun eine deutliche Verbesserung feststellen. Für die durch das Unwetter »Bernd« zerstörten Bahnstrecken wurden ab dem Betriebsjahr 2022 angepasste Fahrpläne entwickelt, sodass diese in der Statistik nicht mehr auftauchen. Die durchschnittlichen Zugausfälle sind von 13,35 Prozent in 2021 auf 9,48 Prozent in 2022 gesunken. Dies entspricht einem Rückgang von 28,98 Prozent. Hauptgrund für die trotz des Rückgangs auf einem insgesamt hohen Niveau liegende Ausfallquote ist die ausgeprägte Bautätigkeit. 48 Prozent der Ausfälle sind auf Baustellen zurückzuführen. Des Weiteren verschärft sich die Personalsituation. Aufgrund fehlenden Personals müssen immer wieder Zugleistungen entfallen. Fast 18 Prozent der Zugausfälle lassen sich dieser Ursache zuordnen.
Insgesamt Zunahme der Kapazitätsausfälle
Bei der Bereitstellung der vertraglich vereinbarten Kapazitäten ist die durchschnittliche Quote der Sitzplatzausfälle erneut angestiegen, und zwar von 2,23 Prozent in 2021 auf 2,52 Prozent in 2022 (plus 13 Prozent). Während die RE-Linien auf einem konstanten Niveau liegen, haben sich die RB-Linien und die S-Bahnen verschlechtert. Verantwortlich sind in erster Linie die gesunkene Personalverfügbarkeit im Betrieb und in den Werkstätten sowie Probleme bei der Verfügbarkeit bestimmter Fahrzeugbaureihen aufgrund deren Alters.
Fahrgastzahlen steigen wieder
Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Rückgang der Fahrgastzahlen gab es 2022 wieder einen Anstieg. Die Zahl der täglichen Einsteiger an Werktagen (montags-freitags) ist im Jahresdurchschnitt von rund 244.000 Fahrgästen in 2021 auf 343.000 Fahrgäste in 2022 deutlich gestiegen. Dies entspricht einer Zunahme von rund 41 Prozent. Trotz des Wachstums befinden sich die Fahrgastzahlen noch nicht wieder auf dem Niveau der Zeit vor der Pandemie. Im Vergleich zu den Zahlen aus dem Jahr 2019 wurden nur in den 9-Euro-Ticket-Monaten Juni, Juli und August 2022 höhere Fahrgastzahlen ermittelt. In den restlichen Monaten – insbesondere zu Beginn des Jahres – lagen die Fahrgastzahlen teils weit unter den Werten aus 2019.
Zustand der Fahrzeuge verbessert sich überwiegend
Zum ersten Mal haben im Jahr 2022 die von go.Rheinland beauftragten Profitester*innen auch Daten zum Fahrzeugzustand erhoben. Da nicht auf allen Linien von den Bahnunternehmen Daten geliefert werden können, ergibt sich durch den Einsatz der Profitester*innen ein vollständigeres Bild. Bei der „Funktionalität der Außentüren“ gab es ebenso Verbesserungen wie bei der „Funktionalität der Fahrgastinformationssysteme“, der „Verschmutzung mit Graffiti“ und der „Sauberkeit insgesamt (ohne Graffiti)“. Lediglich in der Kategorie „Funktionalität der Toiletten“ wurde eine leichte Verschlechterung gegenüber 2021 festgestellt.
Kundendialog: Zahl der Fahrgastbeschwerden ist angestiegen
Mit dem go.Rheinland-Kundendialog gibt es ein wichtiges Instrument, um den Fahrgästen die Möglichkeit zu geben, auf Mängel und Probleme im Schienenpersonennahverkehr hinzuweisen. Während es im Jahr 2021 insgesamt 1.231 Kundeneingaben gab, waren es im letzten Jahr 1.380 und damit 149 Eingaben mehr (plus 12,1 Prozent). Die beiden häufigsten Gründe für Beschwerden waren Fahrtverspätungen sowie Fahrtausfälle.
Link zum diesjährigen Qualitätsbericht
Quelle: go.Rheinland GmbH