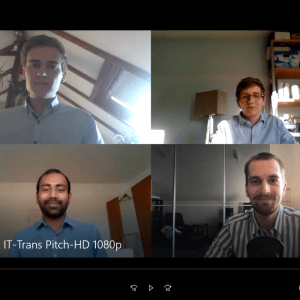Am 28. April 2020 tritt die neue StVO in Kraft. Damit werden alle Regelungen zur Umsetzung des bereits 2017 in Kraft getretenen Carsharinggesetzes (CsgG) endlich getroffen. Für den Bundesverband CarSharing ist die StVO-Novelle ein wichtiges Signal an jene Kommunen, die das CarSharing bisher nicht fördern.
Vor allem das stationsbasierte CarSharing sollte möglichst flächendeckend gefördert werden. Denn diese CarSharing-Variante hat sich in verschiedenen Studien immer wieder als besonders verkehrsentlastend erwiesen. Stationsbasierte Fahrzeuge dürfen aber im öffentlichen Straßenraum nur auf dafür vorgesehenen Stellplätzen bereitgestellt werden. Verbandsgeschäftsführer Nehrke fordert deshalb: „Das stationsbasierte CarSharing muss durch ein flächendeckendes Netz von CarSharing-Stationen in den öffentlichen Raum geholt werden. Dann ist es für Nicht-Kunden sichtbarer und kann seine hohe verkehrsentlastende Wirkung voll entfalten.“
Die StVO-Novelle enthält folgende neue Regelungen zum CarSharing:
• Es gibt nun ein amtliches CarSharing-Schild. Das Schild wird als Zusatzzeichen zum Verkehrszeichen „Parken“ (314 oder 315) verwendet, um CarSharing-Stellplätze zu kennzeichnen.
• Allgemeine CarSharing-Stellplätze im öffentlichen Raum können mit dem amtlichen Schild nun erstmals ausgewiesen werden.
• Anbieterspezifisch zugeordnete Stellplätze für stationsbasierte CarSharing-Fahrzeuge werden laut Carsharinggesetz (CsgG) auf Basis der Sondernutzung eingerichtet. Es gibt daher bereits eine ganze Reihe von Kommunen, die solche Stellplätze im öffentlichen Raum eingerichtet haben. Kommunen können diese Stellplätze nun mit dem CarSharing-Schild und einem Zusatzschild mit dem Namen des Anbieters amtlich kennzeichnen. Damit ist auch die Möglichkeit für eine amtliche Sanktionierung von Falschparkern gegeben.
• CarSharing-Fahrzeuge können mit einer amtlichen Plakette eindeutig gekennzeichnet werden. Die Plakette wird an die CarSharing-Anbieter ausgegeben. Die dafür zuständigen Behörden hat das Bundesverkehrsministerium noch nicht bestimmt.
• Durch ein neu geschaffenes Zusatzschild „CarSharing frei“ wird das Parken von CarSharing-Fahrzeugen jenseits von besonderen CarSharing-Stellplätzen in eingeschränkten Halteverboten oder eingeschränkten Halteverbotszonen ermöglicht. Damit können auch Bewohnerparkzonen für das Parken von CarSharing-Fahrzeugen freigegeben werden.
• CarSharing-Fahrzeuge – und damit CarSharing-Kunden – können durch Zusatzzeichen von der Pflicht befreit werden, in Parkraumbewirtschaftungszonen Parkscheiben, Parkautomaten oder Parkuhren zu nutzen. Dies gilt für alle Straßen.
• Das unberechtigte Parken auf CarSharing-Stellplätzen wird sanktioniert und kostet ab jetzt 55 Euro.
Quelle: Bundesverband CarSharing e.V. (bcs)