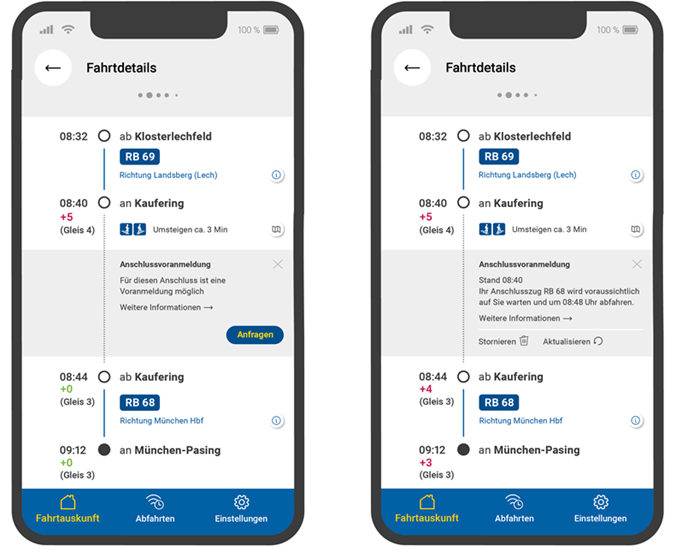Ende des Jahres 2022 erhielt der Landkreis Osnabrück vom Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) den Zuwendungsbescheid für das ÖPNV-Modellprojekt „Mobilität im Osnabrücker Land Integriert und Nachhaltig“ kurz „MOIN+“. Unter den 57 Einreichungen waren deutschlandweit sieben Modellprojekte vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMVD) aufgefordert worden, ihre Ideen in einem Vollantrag darzulegen. Nach der Prüfung hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing sieben Projekte bekannt gegeben, die eine Förderung für konkrete Maßnahmen erhalten – darunter der Landkreis. Das Projekt wird gemeinsam mit der Planungsgesellschaft Osnabrück GmbH (PlaNOS) durchgeführt und hat ein Gesamtvolumen von rund 20 Millionen Euro, von denen bis zu 80 Prozent vom Bund gefördert werden. Im Landkreis Osnabrück wird dabei das einzige ÖPNV-Modellprojekt in Niedersachsen im Rahmen des Förderaufrufs neu gefördert.
Landrätin Anna Kebschull freut sich sehr über den großen Erfolg und dankt allen Beteiligten. Sie ordnet das Projekt wie folgt ein: „Aktuell erarbeiten wir auf Basis umfangreicher Analysen das Mobilitätskonzept für den Landkreis. Das Ziel: Nachhaltigere, sozialere und attraktive Möglichkeiten für die Menschen zu bieten, im Landkreis von A nach B zu kommen. Darin werden Fahrrad, Fußwege, Individual-Verkehre und ÖPNV sowie die Verknüpfung der Angebote berücksichtigt. MOIN+ ist ein erster Baustein: Der Beginn eines langen, spannenden Weges zu einer neuen Mobilität.“
Im Rahmen der Förderung werden bis 2025 verschiedene Kernthemen behandelt: zusätzliche Linienangebote und On-Demand-Verkehre starten in ausgewählten Regionen, Carsharing-Angebote werden ausgebaut und die Infrastruktur zur Verknüpfung verschiedener Mobilitätsangebote wird geschaffen.
Hinter der Ausweitung des Busliniennetzes stehen zwei neue Schnellbuslinien, die für eine schnelle, konkurrenzfähige und damit attraktive Anbindung an Osnabrück sorgen. Außerdem werden zur Angebotsverbesserung zwei neue RegioBuslinien für eine deutlich bessere Vernetzung zwischen den Kommunen im Landkreis sowie Anbindung an den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) bieten.
Um eine flexible und bedarfsorientierte Mobilität zu ermöglichen, werden On-Demand-Verkehre in drei Gemeinden getestet. Kleinbusse können dort per App oder telefonisch nach Bedarf (= On-Demand) bestellt werden. Darüber hinaus werden in jeder der 21 kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises Mobilstationen entstehen. Mit der Ausweitung des Carsharings um 10 weitere Fahrzeuge wird die tageszeitunabhängige, flexible Mobilität des täglichen Bedarfs weiter gestärkt. Das Mobilitätsportal in Stadt und Landkreis führt sämtliche Bausteine digital zusammen und schafft damit einen einfachen und schnellen Zugang zu allen Mobilitätsformen.
Die Maßnahmen werden ab dem Jahr 2024 sukzessive eingeführt. Die Nutzungszahlen und die Akzeptanz werden durch den Fördergeber laufend evaluiert, um darauf aufbauend Erkenntnisse für andere Verkehrsregionen abzuleiten.
Quelle: Landkreis Osnabrück